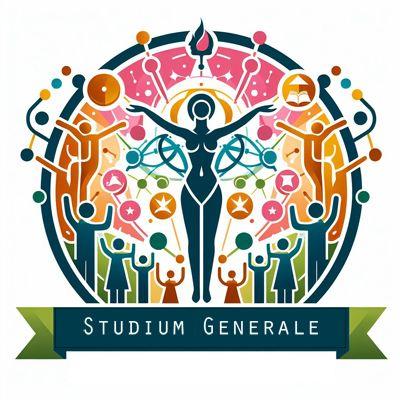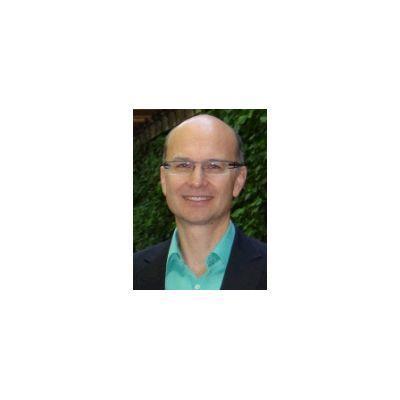Sie sind hier:
Studium Generale
In thematischen Schwerpunkten erfahren Sie im Studium Generale Wissenswertes auf der Höhe der Zeit. Expertinnen und Experten geben Ihnen einen vertieften, wissenschaftlich fundierten Einblick in verschiedene, zusammengehörende Themen, die Ihnen einen Grundstock für Ihre Allgemeinbildung, aber auch zum besseren Verstehen von Entwicklungen in der Jetztzeit geben.
In diesem Semester stehen die Kunst und Ästhetik im Mittelpunkt.
Wie immer können Sie quer einsteigen und benötigen dazu keine besonderen Voraussetzungen.
In diesem Semester stehen die Kunst und Ästhetik im Mittelpunkt.
Wie immer können Sie quer einsteigen und benötigen dazu keine besonderen Voraussetzungen.
24.09.25, Maximilian Zettler, 18:00 bis 19:30 Uhr
"Ich bin viele – das Selbst im Spiegel der Gesellschaft"
Wie wir uns in sozialen Kontexten verhalten und darstellen, ist stark geprägt durch kulturelle Normen, Erwartungen und soziale Rollen. Unsere Identität ist ein Zusammenspiel aus Innen- und Außenwelt.
Der Referent geht auf folgende Aspekte ein:
- Bewusst-Sein im Kontext der Gesellschaft
- Soziale Konstruktion des Selbst
- Soziale Rolle und Rollenerwartungen
- Äußere Selbstinszenierung
- Die Frage nach dem „Warum“
01.10.25, Maximilian Zettler, 18:00 bis 19:30 Uhr
Das wahre Ich: Emotionale Intelligenz im Einklang von Selbst- und Fremdbild
Innere Achtsamkeit und Selbstreflexion helfen, nicht nur sich selbst besser zu verstehen, sondern auch gesunde Beziehungen zu anderen zu führen.
Der Referent geht auf folgende Aspekte ein:
- Emotionale Intelligenz: Eigene und fremde Emotionen erkennen, verstehen, regulieren
- Selbst-Bewusstsein: Reflexion der eigenen Gedanken, Emotionen und Motive
- Abgleich von Selbst- und Fremdwahrnehmung
- Notwendigkeit der Selbstreflexion
08.10. und 15.10.25, Gertrud Roth-Bojadhziev, 18:00 bis 19:30 Uhr
Gärten sind kulturhistorische Dokumente ersten Ranges, die „gelesen“ werden wollen. Sie spiegeln ihre Entstehungszeit und die Beziehung der Menschen zur Natur.
Der mittelalterliche Garten, vor allem der Klostergarten, war ein Gegenbild zur wilden, ungezähmten und gefährlichen Natur. Er diente durchaus zur Selbstversorgung und zum Anbau von Heilkräutern, zur Erholung und Erbauung. Er wurde aber vor allem Vorbild für einige der bedeutendsten mittelalterlichen Bildschöpfungen, ganz besonders die Marienverehrung betreffend, nämlich den „ hortus conclusus“ oder das Paradiesgärtlein und die gemalten „Himmelswiesen“ mancher spätgotischen Kirche.
Im München des 19. Jh., vor allem in der zweiten Hälfte, fand sich ein großer Freundeskreis von Malern, so auch Carl Spitzweg und Eduard Schleich d. Ä., der sich in vielen Wanderungen das Voralpenland, die bayerischen und Tiroler Alpen, die unterschiedlichen Landschaften Frankens und ganz besonders das Ampermoor um Dachau erschloss. Sie konzentrierten sich auf das Thema „Landschaft“ trotz der Geringschätzung durch die Akademie. Diese Landschaftsmaler dokumentierten in vielen Skizzen und Gemälden real existierende Landschaften, malerische Aussichtspunkte und Dorf/Städteansichten, die allmählich durch die Eingriffe des 19. und 20. Jh. zugunsten der Erschließung durch Straßen- und Eisenbahnbau, der Trockenlegung der Moore und der Flussregulierungen stark verändert wurden. Darüber hinaus suchten sie, durch die genaue Beobachtung von Lichteinfall und Beleuchtung, den atmosphärischen Wechsel, der durch Tages- oder Jahreszeiten entsteht. Ihre Bilder sind Dokumente für eine noch von Naturkräften geformte Landschaft und deren besondere Schönheit.
22.10.25, Dr. phil. Dieter Strauß, 18:00 bis 19:30 Uhr
Wenn menschengemachter Klimawandel tötet - Alexander von Humboldt ein früher Influenzer?
In Erinnerung an Humboldts bahnbrechende Erkenntnis vor 225 Jahren
Februar 1800: Humboldt erkennt am Valenziasee im Nordosten Südamerikas die grundlegende Funktion des Waldes für das Ökosystem:
Rodungen verhindern die Co2-Bindungen der Bäume, setzen Treibhausgase frei und stören das klimatische Gleichgewicht.Weiter geht es Schlag auf Schlag: Humboldt erfasst das Ineinandergreifen der Ausbeutung natürlicher Ressourcen und Menschen, spricht sich für die universalen Menschenrechte und gegen Kolonisation und Raubtierkapitalismus aus. Und schließlich: er bringt Kunst und Naturwissenschaften zusammen. Begleiten Sie Humboldt auf seinen beiden großen Erkenntnisreisen, auf seiner spannenden Lateinamerika- (1799-1804) und Asien-Expedition (1829).
Der Referent Dr. Dieter Strauss hat 33 Jahre als Leiter von Goethe-Instituten in vier Kontinenten gearbeitet und die langjährige Brasilienexpedition des „Humboldts Brasiliens“, Baron Georg Heinrich von Langsdorff, wiederholt und dazu eine Ausstellung organisiert, die der damalige Bundespräsiden Roman Herzog in Sao Paulo eröffnet hat.
29.10.25, Michael Trieb, 18:00 bis 19:30 Uhr
Die verborgene Sprache der Bäume (Film)
Ein Förster wird zum Sprachrohr des Waldes: Peter Wohlleben zeigt in dieser Doku, wie Bäume miteinander kommunizieren und ein komplexes Sozialleben führen. Basierend auf seinem Bestseller, bietet der Film faszinierende Naturaufnahmen, kritisiert die moderne Forstwirtschaft und öffnet den Blick für ein neues, respektvolles Verständnis des Waldes. Ein eindrucksvolles Porträt voller Wissen, Humor und Herz.
05.11.25, Dr. Michael F. Schneider, 18:00 bis 19:30 Uhr
Klimawandel – Einfluss auf Natur und Mensch im Allgäu
Unser Klima wird immer verrückter: Der heißeste, der stürmischste, der trockenste, der kälteste… Es vergeht kaum kein Monat ohne neuen Superlativ. Welche Folgen aber hat der Klimawandel auf unsere Tier- und Pflanzenwelt? Der Klimawandel bringt die Jahreszeiten durcheinander und damit nicht nur den Fahrplan der Zugvögel. Fürsorgliche Vogeleltern auf der Suche nach Futter für ihre Brut schauen in die Röhre, da die Entwicklung von Insekten und Vögeln zusehends asynchron verläuft. Pflanzen blühen früher und fallen späten Frösten zum Opfer. Gebietsfremde Arten, Schädlinge und Krankheiten sind Gewinner des Klimawandels und können bereits in unseren Breiten angetroffen werden. Die Alpen und ihre Lebensräume reagieren besonders empfindlich auf den Klimawandel. Da es wärmer wird, folgen Tiere und Pflanzen ihrem Temperaturoptimum und „wandern“ weiter nach oben. Was passiert, wenn sie das Ende der Fahnenstange erreicht haben? Welche wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen bringt der Klimawandel mit sich? Welche Folgen hat der Klimawandel schließlich auf unsere Freizeitaktivitäten? Wie steht es um den Skitourismus? Im Vortrag wird versucht, anhand von eigenen Untersuchungen und Beispielen aus dem Allgäu Antworten auf einige dieser Fragen zu finden.
12.11.25, Dr. Christoph Pöhlmann, 18:00 bis 19:30 Uhr
Multiresistente Keime – wieso sie zunehmen und wie man sich schützen kann
Bakterien eilt der Ruf als Krankheitserreger voraus. Doch unsere Keimflora auf der Haut und den Schleimhäuten hat wichtige Schutzfunktionen. Sie sorgt z. B. dafür, dass krank machende Erreger nicht ungehindert in den Körper eindringen können. Gelangen Erreger über Eintrittspforten wie z. B. Wunden in den Körper, bekämpft unser Immunsystem die Eindringlinge. Eine sog. Infektion im Körper entsteht. Die meisten bakteriellen Infektionen lassen sich gut mit Medikamenten, sog. Antibiotika, behandeln.
Woher kommen multiresistente Keime eigentlich?
Wird die Infektion durch multiresistente Erreger ausgelöst, ist ein Teil der zur Verfügung stehenden Antibiotika nicht mehr wirksam. Eine wesentliche Ursache für die Abnahme der Wirksamkeit von Antibiotika besteht darin, dass sie weltweit zu häufig und oft zu leichtfertig angewendet werden, wodurch resistente Bakterienstämme selektiert werden. Auch die unsachgerechte Entsorgung von Produktionsabfällen bei der Herstellung von Antibiotika induziert die Resistenzentwicklung in Umweltbakterien.
Wie kann ich mich schützen?
Multiresistente Keime werden meist direkt, z.B. über die Hände, oder indirekt über kontaminierte Gegenstände übertragen. Für gesunde Menschen stellt die Übertragung i.d.R. kein Gesundheitsrisiko dar. Gefährdet für eine Infektion mit multiresistenten Keimen sind v. a. abwehrgeschwächte bzw. chronisch kranke Patienten. Zum Schutz vor einer Übertragung spielt die persönliche Hygiene, v.a. die Händedesinfektion, eine große Rolle
19.11.25, Hannah Eichhorn, 18:00 bis 19:30 Uhr
Vom Denken ins Handeln kommen
An diesem Abend werden wir tiefer in das Thema Resilienz (Widerstandskraft bzw. Trotzkraft) eintauchen und verstehen, warum es heilsam ist, aktiv im Klimaschutz zu werden - und wie Sie aktiv werden können.
26.11.25, Dr. Christian Katzschmann, Chefdramaturg und stellv. Intendant am Theater Ulm, 18:00 bis 19:30 Uhr
„Was kann Theater, wenn Gesellschaften wanken?“
In Zeiten des Umbruchs und der Unsicherheit stellt sich die Frage: Welche Rolle kann das Theater spielen, wenn Gesellschaften ins Wanken geraten? Theater ist seit jeher ein Spiegel der Gesellschaft, ein Ort der Reflexion, des Diskurses und der emotionalen Auseinandersetzung. Dr. Katzschmann wird die diese unterschiedlichen Aufgaben des Theaters aufzeigen.
"Ich bin viele – das Selbst im Spiegel der Gesellschaft"
Wie wir uns in sozialen Kontexten verhalten und darstellen, ist stark geprägt durch kulturelle Normen, Erwartungen und soziale Rollen. Unsere Identität ist ein Zusammenspiel aus Innen- und Außenwelt.
Der Referent geht auf folgende Aspekte ein:
- Bewusst-Sein im Kontext der Gesellschaft
- Soziale Konstruktion des Selbst
- Soziale Rolle und Rollenerwartungen
- Äußere Selbstinszenierung
- Die Frage nach dem „Warum“
01.10.25, Maximilian Zettler, 18:00 bis 19:30 Uhr
Das wahre Ich: Emotionale Intelligenz im Einklang von Selbst- und Fremdbild
Innere Achtsamkeit und Selbstreflexion helfen, nicht nur sich selbst besser zu verstehen, sondern auch gesunde Beziehungen zu anderen zu führen.
Der Referent geht auf folgende Aspekte ein:
- Emotionale Intelligenz: Eigene und fremde Emotionen erkennen, verstehen, regulieren
- Selbst-Bewusstsein: Reflexion der eigenen Gedanken, Emotionen und Motive
- Abgleich von Selbst- und Fremdwahrnehmung
- Notwendigkeit der Selbstreflexion
08.10. und 15.10.25, Gertrud Roth-Bojadhziev, 18:00 bis 19:30 Uhr
Gärten sind kulturhistorische Dokumente ersten Ranges, die „gelesen“ werden wollen. Sie spiegeln ihre Entstehungszeit und die Beziehung der Menschen zur Natur.
Der mittelalterliche Garten, vor allem der Klostergarten, war ein Gegenbild zur wilden, ungezähmten und gefährlichen Natur. Er diente durchaus zur Selbstversorgung und zum Anbau von Heilkräutern, zur Erholung und Erbauung. Er wurde aber vor allem Vorbild für einige der bedeutendsten mittelalterlichen Bildschöpfungen, ganz besonders die Marienverehrung betreffend, nämlich den „ hortus conclusus“ oder das Paradiesgärtlein und die gemalten „Himmelswiesen“ mancher spätgotischen Kirche.
Im München des 19. Jh., vor allem in der zweiten Hälfte, fand sich ein großer Freundeskreis von Malern, so auch Carl Spitzweg und Eduard Schleich d. Ä., der sich in vielen Wanderungen das Voralpenland, die bayerischen und Tiroler Alpen, die unterschiedlichen Landschaften Frankens und ganz besonders das Ampermoor um Dachau erschloss. Sie konzentrierten sich auf das Thema „Landschaft“ trotz der Geringschätzung durch die Akademie. Diese Landschaftsmaler dokumentierten in vielen Skizzen und Gemälden real existierende Landschaften, malerische Aussichtspunkte und Dorf/Städteansichten, die allmählich durch die Eingriffe des 19. und 20. Jh. zugunsten der Erschließung durch Straßen- und Eisenbahnbau, der Trockenlegung der Moore und der Flussregulierungen stark verändert wurden. Darüber hinaus suchten sie, durch die genaue Beobachtung von Lichteinfall und Beleuchtung, den atmosphärischen Wechsel, der durch Tages- oder Jahreszeiten entsteht. Ihre Bilder sind Dokumente für eine noch von Naturkräften geformte Landschaft und deren besondere Schönheit.
22.10.25, Dr. phil. Dieter Strauß, 18:00 bis 19:30 Uhr
Wenn menschengemachter Klimawandel tötet - Alexander von Humboldt ein früher Influenzer?
In Erinnerung an Humboldts bahnbrechende Erkenntnis vor 225 Jahren
Februar 1800: Humboldt erkennt am Valenziasee im Nordosten Südamerikas die grundlegende Funktion des Waldes für das Ökosystem:
Rodungen verhindern die Co2-Bindungen der Bäume, setzen Treibhausgase frei und stören das klimatische Gleichgewicht.Weiter geht es Schlag auf Schlag: Humboldt erfasst das Ineinandergreifen der Ausbeutung natürlicher Ressourcen und Menschen, spricht sich für die universalen Menschenrechte und gegen Kolonisation und Raubtierkapitalismus aus. Und schließlich: er bringt Kunst und Naturwissenschaften zusammen. Begleiten Sie Humboldt auf seinen beiden großen Erkenntnisreisen, auf seiner spannenden Lateinamerika- (1799-1804) und Asien-Expedition (1829).
Der Referent Dr. Dieter Strauss hat 33 Jahre als Leiter von Goethe-Instituten in vier Kontinenten gearbeitet und die langjährige Brasilienexpedition des „Humboldts Brasiliens“, Baron Georg Heinrich von Langsdorff, wiederholt und dazu eine Ausstellung organisiert, die der damalige Bundespräsiden Roman Herzog in Sao Paulo eröffnet hat.
29.10.25, Michael Trieb, 18:00 bis 19:30 Uhr
Die verborgene Sprache der Bäume (Film)
Ein Förster wird zum Sprachrohr des Waldes: Peter Wohlleben zeigt in dieser Doku, wie Bäume miteinander kommunizieren und ein komplexes Sozialleben führen. Basierend auf seinem Bestseller, bietet der Film faszinierende Naturaufnahmen, kritisiert die moderne Forstwirtschaft und öffnet den Blick für ein neues, respektvolles Verständnis des Waldes. Ein eindrucksvolles Porträt voller Wissen, Humor und Herz.
05.11.25, Dr. Michael F. Schneider, 18:00 bis 19:30 Uhr
Klimawandel – Einfluss auf Natur und Mensch im Allgäu
Unser Klima wird immer verrückter: Der heißeste, der stürmischste, der trockenste, der kälteste… Es vergeht kaum kein Monat ohne neuen Superlativ. Welche Folgen aber hat der Klimawandel auf unsere Tier- und Pflanzenwelt? Der Klimawandel bringt die Jahreszeiten durcheinander und damit nicht nur den Fahrplan der Zugvögel. Fürsorgliche Vogeleltern auf der Suche nach Futter für ihre Brut schauen in die Röhre, da die Entwicklung von Insekten und Vögeln zusehends asynchron verläuft. Pflanzen blühen früher und fallen späten Frösten zum Opfer. Gebietsfremde Arten, Schädlinge und Krankheiten sind Gewinner des Klimawandels und können bereits in unseren Breiten angetroffen werden. Die Alpen und ihre Lebensräume reagieren besonders empfindlich auf den Klimawandel. Da es wärmer wird, folgen Tiere und Pflanzen ihrem Temperaturoptimum und „wandern“ weiter nach oben. Was passiert, wenn sie das Ende der Fahnenstange erreicht haben? Welche wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen bringt der Klimawandel mit sich? Welche Folgen hat der Klimawandel schließlich auf unsere Freizeitaktivitäten? Wie steht es um den Skitourismus? Im Vortrag wird versucht, anhand von eigenen Untersuchungen und Beispielen aus dem Allgäu Antworten auf einige dieser Fragen zu finden.
12.11.25, Dr. Christoph Pöhlmann, 18:00 bis 19:30 Uhr
Multiresistente Keime – wieso sie zunehmen und wie man sich schützen kann
Bakterien eilt der Ruf als Krankheitserreger voraus. Doch unsere Keimflora auf der Haut und den Schleimhäuten hat wichtige Schutzfunktionen. Sie sorgt z. B. dafür, dass krank machende Erreger nicht ungehindert in den Körper eindringen können. Gelangen Erreger über Eintrittspforten wie z. B. Wunden in den Körper, bekämpft unser Immunsystem die Eindringlinge. Eine sog. Infektion im Körper entsteht. Die meisten bakteriellen Infektionen lassen sich gut mit Medikamenten, sog. Antibiotika, behandeln.
Woher kommen multiresistente Keime eigentlich?
Wird die Infektion durch multiresistente Erreger ausgelöst, ist ein Teil der zur Verfügung stehenden Antibiotika nicht mehr wirksam. Eine wesentliche Ursache für die Abnahme der Wirksamkeit von Antibiotika besteht darin, dass sie weltweit zu häufig und oft zu leichtfertig angewendet werden, wodurch resistente Bakterienstämme selektiert werden. Auch die unsachgerechte Entsorgung von Produktionsabfällen bei der Herstellung von Antibiotika induziert die Resistenzentwicklung in Umweltbakterien.
Wie kann ich mich schützen?
Multiresistente Keime werden meist direkt, z.B. über die Hände, oder indirekt über kontaminierte Gegenstände übertragen. Für gesunde Menschen stellt die Übertragung i.d.R. kein Gesundheitsrisiko dar. Gefährdet für eine Infektion mit multiresistenten Keimen sind v. a. abwehrgeschwächte bzw. chronisch kranke Patienten. Zum Schutz vor einer Übertragung spielt die persönliche Hygiene, v.a. die Händedesinfektion, eine große Rolle
19.11.25, Hannah Eichhorn, 18:00 bis 19:30 Uhr
Vom Denken ins Handeln kommen
An diesem Abend werden wir tiefer in das Thema Resilienz (Widerstandskraft bzw. Trotzkraft) eintauchen und verstehen, warum es heilsam ist, aktiv im Klimaschutz zu werden - und wie Sie aktiv werden können.
26.11.25, Dr. Christian Katzschmann, Chefdramaturg und stellv. Intendant am Theater Ulm, 18:00 bis 19:30 Uhr
„Was kann Theater, wenn Gesellschaften wanken?“
In Zeiten des Umbruchs und der Unsicherheit stellt sich die Frage: Welche Rolle kann das Theater spielen, wenn Gesellschaften ins Wanken geraten? Theater ist seit jeher ein Spiegel der Gesellschaft, ein Ort der Reflexion, des Diskurses und der emotionalen Auseinandersetzung. Dr. Katzschmann wird die diese unterschiedlichen Aufgaben des Theaters aufzeigen.
Kurstermine 10
-
Ort / Raum
-
- 1
- Mittwoch, 24. September 2025
- 18:00 – 19:30 Uhr
- Kolbehaus, Donaustr. 1, Eingang 1, Raum 3
1 Mittwoch • 24. September 2025 • 18:00 – 19:30 Uhr Kolbehaus, Donaustr. 1, Eingang 1, Raum 3 -
- 2
- Mittwoch, 01. Oktober 2025
- 18:00 – 19:30 Uhr
- Kolbehaus, Donaustr. 1, Eingang 1, Raum 3
2 Mittwoch • 01. Oktober 2025 • 18:00 – 19:30 Uhr Kolbehaus, Donaustr. 1, Eingang 1, Raum 3 -
- 3
- Mittwoch, 08. Oktober 2025
- 18:00 – 19:30 Uhr
- Kolbehaus, Donaustr. 1, Eingang 1, Raum 3
3 Mittwoch • 08. Oktober 2025 • 18:00 – 19:30 Uhr Kolbehaus, Donaustr. 1, Eingang 1, Raum 3 -
- 4
- Mittwoch, 15. Oktober 2025
- 18:00 – 19:30 Uhr
- Kolbehaus, Donaustr. 1, Eingang 1, Raum 3
4 Mittwoch • 15. Oktober 2025 • 18:00 – 19:30 Uhr Kolbehaus, Donaustr. 1, Eingang 1, Raum 3 - 4 vergangene Termine
-
- 5
- Mittwoch, 22. Oktober 2025
- 18:00 – 19:30 Uhr
- Kolbehaus, Donaustr. 1, Eingang 1, Raum 3
5 Mittwoch • 22. Oktober 2025 • 18:00 – 19:30 Uhr Kolbehaus, Donaustr. 1, Eingang 1, Raum 3 -
- 6
- Mittwoch, 29. Oktober 2025
- 18:00 – 19:30 Uhr
- Kolbehaus, Donaustr. 1, Eingang 1, Raum 3
6 Mittwoch • 29. Oktober 2025 • 18:00 – 19:30 Uhr Kolbehaus, Donaustr. 1, Eingang 1, Raum 3 -
- 7
- Mittwoch, 05. November 2025
- 18:00 – 19:30 Uhr
- Kolbehaus, Donaustr. 1, Eingang 1, Raum 3
7 Mittwoch • 05. November 2025 • 18:00 – 19:30 Uhr Kolbehaus, Donaustr. 1, Eingang 1, Raum 3 -
- 8
- Mittwoch, 12. November 2025
- 18:00 – 19:30 Uhr
- Kolbehaus, Donaustr. 1, Eingang 1, Raum 3
8 Mittwoch • 12. November 2025 • 18:00 – 19:30 Uhr Kolbehaus, Donaustr. 1, Eingang 1, Raum 3 -
- 9
- Mittwoch, 19. November 2025
- 18:00 – 19:30 Uhr
- Kolbehaus, Donaustr. 1, Eingang 1, Raum 3
9 Mittwoch • 19. November 2025 • 18:00 – 19:30 Uhr Kolbehaus, Donaustr. 1, Eingang 1, Raum 3 -
- 10
- Mittwoch, 26. November 2025
- 18:00 – 19:30 Uhr
- Kolbehaus, Donaustr. 1, Eingang 1, Raum 3
10 Mittwoch • 26. November 2025 • 18:00 – 19:30 Uhr Kolbehaus, Donaustr. 1, Eingang 1, Raum 3
Studium Generale
In thematischen Schwerpunkten erfahren Sie im Studium Generale Wissenswertes auf der Höhe der Zeit. Expertinnen und Experten geben Ihnen einen vertieften, wissenschaftlich fundierten Einblick in verschiedene, zusammengehörende Themen, die Ihnen einen Grundstock für Ihre Allgemeinbildung, aber auch zum besseren Verstehen von Entwicklungen in der Jetztzeit geben.
In diesem Semester stehen die Kunst und Ästhetik im Mittelpunkt.
Wie immer können Sie quer einsteigen und benötigen dazu keine besonderen Voraussetzungen.
In diesem Semester stehen die Kunst und Ästhetik im Mittelpunkt.
Wie immer können Sie quer einsteigen und benötigen dazu keine besonderen Voraussetzungen.
24.09.25, Maximilian Zettler, 18:00 bis 19:30 Uhr
"Ich bin viele – das Selbst im Spiegel der Gesellschaft"
Wie wir uns in sozialen Kontexten verhalten und darstellen, ist stark geprägt durch kulturelle Normen, Erwartungen und soziale Rollen. Unsere Identität ist ein Zusammenspiel aus Innen- und Außenwelt.
Der Referent geht auf folgende Aspekte ein:
- Bewusst-Sein im Kontext der Gesellschaft
- Soziale Konstruktion des Selbst
- Soziale Rolle und Rollenerwartungen
- Äußere Selbstinszenierung
- Die Frage nach dem „Warum“
01.10.25, Maximilian Zettler, 18:00 bis 19:30 Uhr
Das wahre Ich: Emotionale Intelligenz im Einklang von Selbst- und Fremdbild
Innere Achtsamkeit und Selbstreflexion helfen, nicht nur sich selbst besser zu verstehen, sondern auch gesunde Beziehungen zu anderen zu führen.
Der Referent geht auf folgende Aspekte ein:
- Emotionale Intelligenz: Eigene und fremde Emotionen erkennen, verstehen, regulieren
- Selbst-Bewusstsein: Reflexion der eigenen Gedanken, Emotionen und Motive
- Abgleich von Selbst- und Fremdwahrnehmung
- Notwendigkeit der Selbstreflexion
08.10. und 15.10.25, Gertrud Roth-Bojadhziev, 18:00 bis 19:30 Uhr
Gärten sind kulturhistorische Dokumente ersten Ranges, die „gelesen“ werden wollen. Sie spiegeln ihre Entstehungszeit und die Beziehung der Menschen zur Natur.
Der mittelalterliche Garten, vor allem der Klostergarten, war ein Gegenbild zur wilden, ungezähmten und gefährlichen Natur. Er diente durchaus zur Selbstversorgung und zum Anbau von Heilkräutern, zur Erholung und Erbauung. Er wurde aber vor allem Vorbild für einige der bedeutendsten mittelalterlichen Bildschöpfungen, ganz besonders die Marienverehrung betreffend, nämlich den „ hortus conclusus“ oder das Paradiesgärtlein und die gemalten „Himmelswiesen“ mancher spätgotischen Kirche.
Im München des 19. Jh., vor allem in der zweiten Hälfte, fand sich ein großer Freundeskreis von Malern, so auch Carl Spitzweg und Eduard Schleich d. Ä., der sich in vielen Wanderungen das Voralpenland, die bayerischen und Tiroler Alpen, die unterschiedlichen Landschaften Frankens und ganz besonders das Ampermoor um Dachau erschloss. Sie konzentrierten sich auf das Thema „Landschaft“ trotz der Geringschätzung durch die Akademie. Diese Landschaftsmaler dokumentierten in vielen Skizzen und Gemälden real existierende Landschaften, malerische Aussichtspunkte und Dorf/Städteansichten, die allmählich durch die Eingriffe des 19. und 20. Jh. zugunsten der Erschließung durch Straßen- und Eisenbahnbau, der Trockenlegung der Moore und der Flussregulierungen stark verändert wurden. Darüber hinaus suchten sie, durch die genaue Beobachtung von Lichteinfall und Beleuchtung, den atmosphärischen Wechsel, der durch Tages- oder Jahreszeiten entsteht. Ihre Bilder sind Dokumente für eine noch von Naturkräften geformte Landschaft und deren besondere Schönheit.
22.10.25, Dr. phil. Dieter Strauß, 18:00 bis 19:30 Uhr
Wenn menschengemachter Klimawandel tötet - Alexander von Humboldt ein früher Influenzer?
In Erinnerung an Humboldts bahnbrechende Erkenntnis vor 225 Jahren
Februar 1800: Humboldt erkennt am Valenziasee im Nordosten Südamerikas die grundlegende Funktion des Waldes für das Ökosystem:
Rodungen verhindern die Co2-Bindungen der Bäume, setzen Treibhausgase frei und stören das klimatische Gleichgewicht.Weiter geht es Schlag auf Schlag: Humboldt erfasst das Ineinandergreifen der Ausbeutung natürlicher Ressourcen und Menschen, spricht sich für die universalen Menschenrechte und gegen Kolonisation und Raubtierkapitalismus aus. Und schließlich: er bringt Kunst und Naturwissenschaften zusammen. Begleiten Sie Humboldt auf seinen beiden großen Erkenntnisreisen, auf seiner spannenden Lateinamerika- (1799-1804) und Asien-Expedition (1829).
Der Referent Dr. Dieter Strauss hat 33 Jahre als Leiter von Goethe-Instituten in vier Kontinenten gearbeitet und die langjährige Brasilienexpedition des „Humboldts Brasiliens“, Baron Georg Heinrich von Langsdorff, wiederholt und dazu eine Ausstellung organisiert, die der damalige Bundespräsiden Roman Herzog in Sao Paulo eröffnet hat.
29.10.25, Michael Trieb, 18:00 bis 19:30 Uhr
Die verborgene Sprache der Bäume (Film)
Ein Förster wird zum Sprachrohr des Waldes: Peter Wohlleben zeigt in dieser Doku, wie Bäume miteinander kommunizieren und ein komplexes Sozialleben führen. Basierend auf seinem Bestseller, bietet der Film faszinierende Naturaufnahmen, kritisiert die moderne Forstwirtschaft und öffnet den Blick für ein neues, respektvolles Verständnis des Waldes. Ein eindrucksvolles Porträt voller Wissen, Humor und Herz.
05.11.25, Dr. Michael F. Schneider, 18:00 bis 19:30 Uhr
Klimawandel – Einfluss auf Natur und Mensch im Allgäu
Unser Klima wird immer verrückter: Der heißeste, der stürmischste, der trockenste, der kälteste… Es vergeht kaum kein Monat ohne neuen Superlativ. Welche Folgen aber hat der Klimawandel auf unsere Tier- und Pflanzenwelt? Der Klimawandel bringt die Jahreszeiten durcheinander und damit nicht nur den Fahrplan der Zugvögel. Fürsorgliche Vogeleltern auf der Suche nach Futter für ihre Brut schauen in die Röhre, da die Entwicklung von Insekten und Vögeln zusehends asynchron verläuft. Pflanzen blühen früher und fallen späten Frösten zum Opfer. Gebietsfremde Arten, Schädlinge und Krankheiten sind Gewinner des Klimawandels und können bereits in unseren Breiten angetroffen werden. Die Alpen und ihre Lebensräume reagieren besonders empfindlich auf den Klimawandel. Da es wärmer wird, folgen Tiere und Pflanzen ihrem Temperaturoptimum und „wandern“ weiter nach oben. Was passiert, wenn sie das Ende der Fahnenstange erreicht haben? Welche wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen bringt der Klimawandel mit sich? Welche Folgen hat der Klimawandel schließlich auf unsere Freizeitaktivitäten? Wie steht es um den Skitourismus? Im Vortrag wird versucht, anhand von eigenen Untersuchungen und Beispielen aus dem Allgäu Antworten auf einige dieser Fragen zu finden.
12.11.25, Dr. Christoph Pöhlmann, 18:00 bis 19:30 Uhr
Multiresistente Keime – wieso sie zunehmen und wie man sich schützen kann
Bakterien eilt der Ruf als Krankheitserreger voraus. Doch unsere Keimflora auf der Haut und den Schleimhäuten hat wichtige Schutzfunktionen. Sie sorgt z. B. dafür, dass krank machende Erreger nicht ungehindert in den Körper eindringen können. Gelangen Erreger über Eintrittspforten wie z. B. Wunden in den Körper, bekämpft unser Immunsystem die Eindringlinge. Eine sog. Infektion im Körper entsteht. Die meisten bakteriellen Infektionen lassen sich gut mit Medikamenten, sog. Antibiotika, behandeln.
Woher kommen multiresistente Keime eigentlich?
Wird die Infektion durch multiresistente Erreger ausgelöst, ist ein Teil der zur Verfügung stehenden Antibiotika nicht mehr wirksam. Eine wesentliche Ursache für die Abnahme der Wirksamkeit von Antibiotika besteht darin, dass sie weltweit zu häufig und oft zu leichtfertig angewendet werden, wodurch resistente Bakterienstämme selektiert werden. Auch die unsachgerechte Entsorgung von Produktionsabfällen bei der Herstellung von Antibiotika induziert die Resistenzentwicklung in Umweltbakterien.
Wie kann ich mich schützen?
Multiresistente Keime werden meist direkt, z.B. über die Hände, oder indirekt über kontaminierte Gegenstände übertragen. Für gesunde Menschen stellt die Übertragung i.d.R. kein Gesundheitsrisiko dar. Gefährdet für eine Infektion mit multiresistenten Keimen sind v. a. abwehrgeschwächte bzw. chronisch kranke Patienten. Zum Schutz vor einer Übertragung spielt die persönliche Hygiene, v.a. die Händedesinfektion, eine große Rolle
19.11.25, Hannah Eichhorn, 18:00 bis 19:30 Uhr
Vom Denken ins Handeln kommen
An diesem Abend werden wir tiefer in das Thema Resilienz (Widerstandskraft bzw. Trotzkraft) eintauchen und verstehen, warum es heilsam ist, aktiv im Klimaschutz zu werden - und wie Sie aktiv werden können.
26.11.25, Dr. Christian Katzschmann, Chefdramaturg und stellv. Intendant am Theater Ulm, 18:00 bis 19:30 Uhr
„Was kann Theater, wenn Gesellschaften wanken?“
In Zeiten des Umbruchs und der Unsicherheit stellt sich die Frage: Welche Rolle kann das Theater spielen, wenn Gesellschaften ins Wanken geraten? Theater ist seit jeher ein Spiegel der Gesellschaft, ein Ort der Reflexion, des Diskurses und der emotionalen Auseinandersetzung. Dr. Katzschmann wird die diese unterschiedlichen Aufgaben des Theaters aufzeigen.
"Ich bin viele – das Selbst im Spiegel der Gesellschaft"
Wie wir uns in sozialen Kontexten verhalten und darstellen, ist stark geprägt durch kulturelle Normen, Erwartungen und soziale Rollen. Unsere Identität ist ein Zusammenspiel aus Innen- und Außenwelt.
Der Referent geht auf folgende Aspekte ein:
- Bewusst-Sein im Kontext der Gesellschaft
- Soziale Konstruktion des Selbst
- Soziale Rolle und Rollenerwartungen
- Äußere Selbstinszenierung
- Die Frage nach dem „Warum“
01.10.25, Maximilian Zettler, 18:00 bis 19:30 Uhr
Das wahre Ich: Emotionale Intelligenz im Einklang von Selbst- und Fremdbild
Innere Achtsamkeit und Selbstreflexion helfen, nicht nur sich selbst besser zu verstehen, sondern auch gesunde Beziehungen zu anderen zu führen.
Der Referent geht auf folgende Aspekte ein:
- Emotionale Intelligenz: Eigene und fremde Emotionen erkennen, verstehen, regulieren
- Selbst-Bewusstsein: Reflexion der eigenen Gedanken, Emotionen und Motive
- Abgleich von Selbst- und Fremdwahrnehmung
- Notwendigkeit der Selbstreflexion
08.10. und 15.10.25, Gertrud Roth-Bojadhziev, 18:00 bis 19:30 Uhr
Gärten sind kulturhistorische Dokumente ersten Ranges, die „gelesen“ werden wollen. Sie spiegeln ihre Entstehungszeit und die Beziehung der Menschen zur Natur.
Der mittelalterliche Garten, vor allem der Klostergarten, war ein Gegenbild zur wilden, ungezähmten und gefährlichen Natur. Er diente durchaus zur Selbstversorgung und zum Anbau von Heilkräutern, zur Erholung und Erbauung. Er wurde aber vor allem Vorbild für einige der bedeutendsten mittelalterlichen Bildschöpfungen, ganz besonders die Marienverehrung betreffend, nämlich den „ hortus conclusus“ oder das Paradiesgärtlein und die gemalten „Himmelswiesen“ mancher spätgotischen Kirche.
Im München des 19. Jh., vor allem in der zweiten Hälfte, fand sich ein großer Freundeskreis von Malern, so auch Carl Spitzweg und Eduard Schleich d. Ä., der sich in vielen Wanderungen das Voralpenland, die bayerischen und Tiroler Alpen, die unterschiedlichen Landschaften Frankens und ganz besonders das Ampermoor um Dachau erschloss. Sie konzentrierten sich auf das Thema „Landschaft“ trotz der Geringschätzung durch die Akademie. Diese Landschaftsmaler dokumentierten in vielen Skizzen und Gemälden real existierende Landschaften, malerische Aussichtspunkte und Dorf/Städteansichten, die allmählich durch die Eingriffe des 19. und 20. Jh. zugunsten der Erschließung durch Straßen- und Eisenbahnbau, der Trockenlegung der Moore und der Flussregulierungen stark verändert wurden. Darüber hinaus suchten sie, durch die genaue Beobachtung von Lichteinfall und Beleuchtung, den atmosphärischen Wechsel, der durch Tages- oder Jahreszeiten entsteht. Ihre Bilder sind Dokumente für eine noch von Naturkräften geformte Landschaft und deren besondere Schönheit.
22.10.25, Dr. phil. Dieter Strauß, 18:00 bis 19:30 Uhr
Wenn menschengemachter Klimawandel tötet - Alexander von Humboldt ein früher Influenzer?
In Erinnerung an Humboldts bahnbrechende Erkenntnis vor 225 Jahren
Februar 1800: Humboldt erkennt am Valenziasee im Nordosten Südamerikas die grundlegende Funktion des Waldes für das Ökosystem:
Rodungen verhindern die Co2-Bindungen der Bäume, setzen Treibhausgase frei und stören das klimatische Gleichgewicht.Weiter geht es Schlag auf Schlag: Humboldt erfasst das Ineinandergreifen der Ausbeutung natürlicher Ressourcen und Menschen, spricht sich für die universalen Menschenrechte und gegen Kolonisation und Raubtierkapitalismus aus. Und schließlich: er bringt Kunst und Naturwissenschaften zusammen. Begleiten Sie Humboldt auf seinen beiden großen Erkenntnisreisen, auf seiner spannenden Lateinamerika- (1799-1804) und Asien-Expedition (1829).
Der Referent Dr. Dieter Strauss hat 33 Jahre als Leiter von Goethe-Instituten in vier Kontinenten gearbeitet und die langjährige Brasilienexpedition des „Humboldts Brasiliens“, Baron Georg Heinrich von Langsdorff, wiederholt und dazu eine Ausstellung organisiert, die der damalige Bundespräsiden Roman Herzog in Sao Paulo eröffnet hat.
29.10.25, Michael Trieb, 18:00 bis 19:30 Uhr
Die verborgene Sprache der Bäume (Film)
Ein Förster wird zum Sprachrohr des Waldes: Peter Wohlleben zeigt in dieser Doku, wie Bäume miteinander kommunizieren und ein komplexes Sozialleben führen. Basierend auf seinem Bestseller, bietet der Film faszinierende Naturaufnahmen, kritisiert die moderne Forstwirtschaft und öffnet den Blick für ein neues, respektvolles Verständnis des Waldes. Ein eindrucksvolles Porträt voller Wissen, Humor und Herz.
05.11.25, Dr. Michael F. Schneider, 18:00 bis 19:30 Uhr
Klimawandel – Einfluss auf Natur und Mensch im Allgäu
Unser Klima wird immer verrückter: Der heißeste, der stürmischste, der trockenste, der kälteste… Es vergeht kaum kein Monat ohne neuen Superlativ. Welche Folgen aber hat der Klimawandel auf unsere Tier- und Pflanzenwelt? Der Klimawandel bringt die Jahreszeiten durcheinander und damit nicht nur den Fahrplan der Zugvögel. Fürsorgliche Vogeleltern auf der Suche nach Futter für ihre Brut schauen in die Röhre, da die Entwicklung von Insekten und Vögeln zusehends asynchron verläuft. Pflanzen blühen früher und fallen späten Frösten zum Opfer. Gebietsfremde Arten, Schädlinge und Krankheiten sind Gewinner des Klimawandels und können bereits in unseren Breiten angetroffen werden. Die Alpen und ihre Lebensräume reagieren besonders empfindlich auf den Klimawandel. Da es wärmer wird, folgen Tiere und Pflanzen ihrem Temperaturoptimum und „wandern“ weiter nach oben. Was passiert, wenn sie das Ende der Fahnenstange erreicht haben? Welche wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen bringt der Klimawandel mit sich? Welche Folgen hat der Klimawandel schließlich auf unsere Freizeitaktivitäten? Wie steht es um den Skitourismus? Im Vortrag wird versucht, anhand von eigenen Untersuchungen und Beispielen aus dem Allgäu Antworten auf einige dieser Fragen zu finden.
12.11.25, Dr. Christoph Pöhlmann, 18:00 bis 19:30 Uhr
Multiresistente Keime – wieso sie zunehmen und wie man sich schützen kann
Bakterien eilt der Ruf als Krankheitserreger voraus. Doch unsere Keimflora auf der Haut und den Schleimhäuten hat wichtige Schutzfunktionen. Sie sorgt z. B. dafür, dass krank machende Erreger nicht ungehindert in den Körper eindringen können. Gelangen Erreger über Eintrittspforten wie z. B. Wunden in den Körper, bekämpft unser Immunsystem die Eindringlinge. Eine sog. Infektion im Körper entsteht. Die meisten bakteriellen Infektionen lassen sich gut mit Medikamenten, sog. Antibiotika, behandeln.
Woher kommen multiresistente Keime eigentlich?
Wird die Infektion durch multiresistente Erreger ausgelöst, ist ein Teil der zur Verfügung stehenden Antibiotika nicht mehr wirksam. Eine wesentliche Ursache für die Abnahme der Wirksamkeit von Antibiotika besteht darin, dass sie weltweit zu häufig und oft zu leichtfertig angewendet werden, wodurch resistente Bakterienstämme selektiert werden. Auch die unsachgerechte Entsorgung von Produktionsabfällen bei der Herstellung von Antibiotika induziert die Resistenzentwicklung in Umweltbakterien.
Wie kann ich mich schützen?
Multiresistente Keime werden meist direkt, z.B. über die Hände, oder indirekt über kontaminierte Gegenstände übertragen. Für gesunde Menschen stellt die Übertragung i.d.R. kein Gesundheitsrisiko dar. Gefährdet für eine Infektion mit multiresistenten Keimen sind v. a. abwehrgeschwächte bzw. chronisch kranke Patienten. Zum Schutz vor einer Übertragung spielt die persönliche Hygiene, v.a. die Händedesinfektion, eine große Rolle
19.11.25, Hannah Eichhorn, 18:00 bis 19:30 Uhr
Vom Denken ins Handeln kommen
An diesem Abend werden wir tiefer in das Thema Resilienz (Widerstandskraft bzw. Trotzkraft) eintauchen und verstehen, warum es heilsam ist, aktiv im Klimaschutz zu werden - und wie Sie aktiv werden können.
26.11.25, Dr. Christian Katzschmann, Chefdramaturg und stellv. Intendant am Theater Ulm, 18:00 bis 19:30 Uhr
„Was kann Theater, wenn Gesellschaften wanken?“
In Zeiten des Umbruchs und der Unsicherheit stellt sich die Frage: Welche Rolle kann das Theater spielen, wenn Gesellschaften ins Wanken geraten? Theater ist seit jeher ein Spiegel der Gesellschaft, ein Ort der Reflexion, des Diskurses und der emotionalen Auseinandersetzung. Dr. Katzschmann wird die diese unterschiedlichen Aufgaben des Theaters aufzeigen.
-
Gebühr90,00 €(für 10 Veranstaltungen) / 54,00 € (für 5 Veranstaltungen) Außerhalb dieser Pakete können keine Einzelveranstaltungen gebucht werden.
- Kursnummer: 252MM1030
-
StartMi. 24.09.2025
18:00 UhrEndeMi. 26.11.2025
19:30 Uhr -
10 Abende Termine
- Geschäftsstelle: Memmingen